Zurück im europäischen Wettbewerb

Dieses Jahr standen Forschenden in der Schweiz erstmals wieder die Tore zu den Fördermassnahmen des European Research Council (ERC) offen. Nach drei Jahren der Ersatzfinanzierung durch den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) konnten sich Wissenschaftler:innen nun wieder im europäischen Wettbewerb messen und an den Ausschreibungen des ERC Starting Grant, ERC Synergy Grant, ERC Consolidator Grant und ERC Proof of Concept Grant beteiligen.
Im Programmjahr 2025 gehen zwei ERC Starting Grants an Forschende der Universität Zürich (UZH). Die Vergabe erfolgt bis zur Unterzeichnung des EU-Programmabkommens (EUPA) im November 2025 noch provisorisch. Erst dann wird die Assoziierung der Schweiz rückwirkend zum 1. Januar 2025 wirksam. Mit den ERC Starting Grants werden Forschungsprojekte mit einem Budget von maximal 1,5 Millionen Euro für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren gefördert.
Bogdan Dereka: Elektrische Felder in der Chemie untersuchen
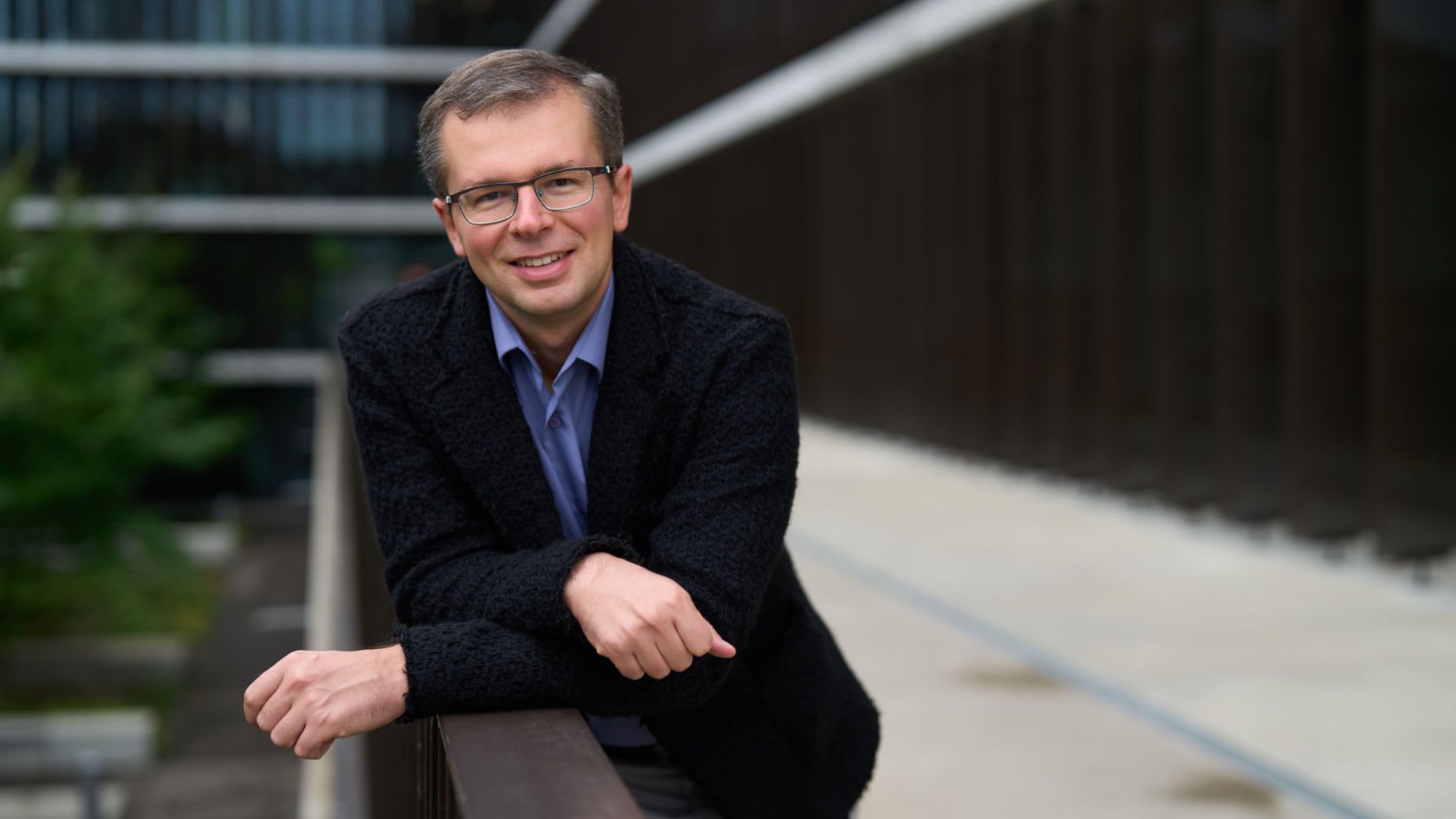
Chemiker:innen sind ständig auf der Suche nach besseren Katalysatoren, um gewünschte Reaktionen zu fördern und unerwünschte zu unterdrücken. Traditionell war die Entwicklung neuer Katalysatoren, die nur unter engen Bedingungen und für eine ganz bestimmte Reaktion funktionieren, ein enorm aufwendiges Unterfangen. Die Natur hingegen nutzt massgeschneiderte elektrische Felder als universelle Katalysatoren, um eine Vielzahl komplexer biologischer Reaktionen auszuführen.
In den letzten Jahren hat sich zunehmend gezeigt, dass sich elektrische Felder auch im Labor nutzen lassen. Doch anders als herkömmliche Katalysatoren lassen sich elektrische Felder nur schwer isolieren, charakterisieren oder präzise steuern. Bisher wurde ihr Einfluss nach dem empirischen Trial-and-Error-Prinzip erforscht.
Das Projekt EFFICACY (Electric Field eFfects In Chemistry And CatalYsis) von Bogdan Dereka, Gruppenleiter Molekulare Photochemie und Photophysik am Institut für Chemie der UZH, zielt darauf ab, die mikroskopischen Eigenschaften, die Dynamik und die Rolle elektrischer Felder in der Chemie auf einer fundamentalen Ebene zu untersuchen. Gemeinsam mit einem Team von Nachwuchsforschenden möchte er die Grundregeln aufdecken, wie diese Felder charakterisiert und in einer vorhersagbaren und breit einsetzbaren Weise beeinflusst werden können – und so den Weg ebnen für eine «elektrische Programmierung» chemischer Reaktivität ohne Elektronenverbrauch.
Martin Pačesa: Proteine für DNA- und RNA-Interaktionen designen

Interaktionen zwischen Proteinen und genetischem Material (DNA und RNA) sind zentral für viele Prozesse in unseren Zellen. Gerät dieses Zusammenspiel aus dem Gleichgewicht, können schwere Krankheiten wie Krebs oder Autoimmunstörungen entstehen. Mit herkömmlichen kleinen Molekülen lassen sich solche Interaktionen jedoch kaum beeinflussen, da die Bindungsflächen oft als nicht behandelbar gelten.
Neue Fortschritte in der künstlichen Intelligenz und im Protein-Design eröffnen hier neue Möglichkeiten. Das Projekt «De novo design of modulators for protein-nucleic acid interactions» von Martin Pačesa – der mit dem Grant von der EPFL ans Institut für Pharmakologie und Toxikologie der UZH wechselt – will neuartige Proteine entwickeln, die gezielt Protein–DNA- oder Protein–RNA-Interaktionen erkennen und beeinflussen können. Ein zentraler Bestandteil ist dabei, mehr Strukturdaten zu solchen Komplexen zu generieren, um KI-Modelle zu verbessern und präzisere Designs zu ermöglichen.
Darüber hinaus soll das Projekt neuartige, proteinbasierte «molekulare Maschinen» erschaffen, die zwischen mehreren Formen wechseln können – ein langjähriges Ziel der Proteinwissenschaft. Diese Innovationen könnten neue Werkzeuge für die Biotechnologie, die Synthetische Biologie und die Medizin liefern, mit Anwendungen von der Grundlagenforschung bis zur Entwicklung neuartiger Therapien.
ERC Proof of Concept Grant für Soeren Lienkamp
Bereits im Juli erhielt Soeren Lienkamp mit seinem Team einen ERC Proof of Concept Grant für das Projekt «DiPNET – Direct Reprogramming for Nephrotoxicity Testing», das auf den erfolgreichen Forschungsergebnissen seines ERC Starting Grant von 2020 aufbaut. Ziel ist es, eine neuartige Screening-Plattform zu validieren, die auf direkt umprogrammierten menschlichen Nierenzellen (iRECs) basiert. Mithilfe der Plattform sollen arzneimittelbedingte Nierenschäden besser vorhergesagt werden können. Dieser Ansatz könnte die Patientensicherheit erhöhen und die Entwicklung sichererer Medikamente beschleunigen.
Im Programmjahr 2025 wurde der ERC Proof of Concept Grant erstmals ausgeschrieben. Mit diesem Grant sollen Forschende dabei unterstützt werden, wissenschaftliche Spitzenleistungen in konkrete Innovationen umzusetzen. Diese Förderung steht allein Forschenden offen, die bereits einen ERC Starting Grant erhalten haben. Insgesamt wurden 150 ERC Proof of Concept Grants vergeben.