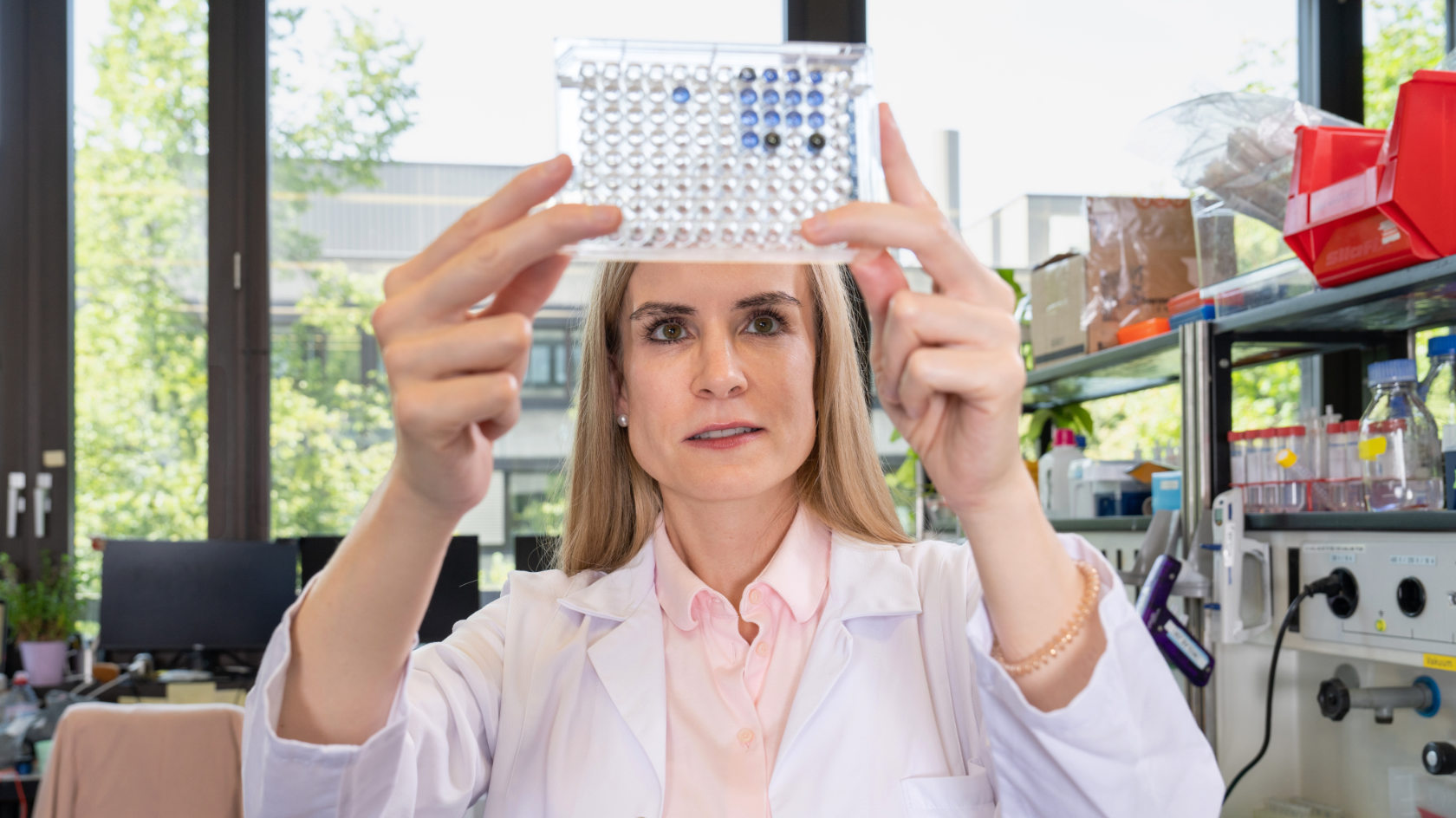Trickreiche Tumoren
Die Diagnose Hirntumor ist heute noch ein Todesurteil. Und der Tod kommt schnell. Menschen mit einem Glioblastom – dem häufigsten bösartigen hirneigenen Tumor – leben nach der Diagnose im Durchschnitt noch 15 Monate. Patientinnen und Patienten mit Hirnmetastasen von anderen Krebsarten wie Brustkrebs, Lungenkrebs oder schwarzem Hautkrebs haben eine mittlere Lebenserwartung von nur einem Jahr. «Bei vielen anderen Krebsarten sind die Behandlungen in den letzten zehn Jahren zielgerichteter und deutlich erfolgreicher geworden», sagt Jenny Kienzler, Neurochirurgin am Universitätsspital Lausanne und Tumorimmunologieforscherin an der UZH.
Nicht so bei Hirntumoren: «Heute gibt es für viele Tumoren in Gehirn noch die gleichen Standardbehandlungen wie vor zwanzig Jahren.» Das will Kienzler ändern. In ihrer Forschung, die vom Fonds zur Förderung des akademischen Nachwuchses von UZH Alumni unterstützt wird, untersucht sie, wie Hirntumoren das körpereigene Immunsystem austricksen, damit sie ungestört wachsen können. So will die Forscherin neue Therapieansätze finden.
Unfassbar aggressiv
Hirntumoren zu therapieren, ist aus mehreren Gründen schwierig. Einer davon ist, dass sie unfassbar aggressiv sind. Ein Glioblastom beispielsweise kann das Tumorvolumen pro Monat um mehr als zwei Kubikzentimeter vergrössern. Es wird darum meist erst entdeckt, wenn es schon gross ist. Und es entwickelt sich häufig bei gesunden und vergleichsweise jungen Leuten, etwa ab 50 Jahren – unabhängig von Risikofaktoren wie Rauchen, Alkoholmissbrauch, Übergewicht oder Bewegungsmangel. Ein weiterer Grund liegt darin, dass Hirnkrebs nie wirklich weg ist. Selbst nach einer operativen Entfernung und der Nachfolgebehandlung kann der Tumor aus zuvor unsichtbaren Schläferzellen wieder nachwachsen.
Und schliesslich hat gerade bei Hirntumoren jener Ansatz kaum eine Verbesserung gebracht, der die Behandlung von anderen Krebsarten in den letzten zehn Jahren richtiggehend revolutioniert hat: die Immuntherapie. Diese nutzt das körpereigene Immunsystem, um Krebs zu bekämpfen. Erfolgreich sind vor allem die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, die verhindern, dass die Tumorzellen mancher Krebsarten das Immunsystem kapern. Denn manche Tumorzellen können sich in die Signalwege des Immunsystems einschalten und sich so quasi davor tarnen, um ihm zu entkommen. Diesen Mechanismus schalten die Checkpoint-Inhibitoren wieder aus, sodass die Immunzellen den Tumor angreifen.
Wächter auf Irrwegen
Nur: Diese Art der Therapie funktioniert bei Tumoren im Gehirn, besonders beim Glioblastom, kaum. Erstens, weil Hirntumorzellen den gesunden Gehirnzellen ähneln und so kaum Angriffsfläche für gezielte Wirkstoffe bieten. Zweitens schaffen die Tumorzellen ein ausgeprägt immunsuppressives Umfeld. Will heissen: Sie schwächen das Immunsystem auf eine nochmals perfidere Weise, als andere Krebsarten dies tun.
Funktioniert das Immunsystem, werden Eindringlinge wie Krankheitserreger oder eben Tumoren systematisch von den Abwehrkräften vernichtet: T-Zellen des Immunsystems werden angezogen und greifen die Tumorzellen an. In einem zweiten Schritt übernehmen Fresszellen, die Makrophagen, und verdauen die Reste. Doch bei Gehirntumoren werden diese Makrophagen häufig umprogrammiert. Dann erledigen sie nicht nur ihre Aufgabe nicht mehr – sie verhindern auch, dass T-Zellen die Tumorzellen bekämpfen. So kann sich der Krebs ungestört ausbreiten. Solche tumorassoziierte Makrophagen machen bis zu 40 Prozent der Zellen in Hirntumorgewebe aus, sie spielen also eine dominante Rolle.
Wie genau sie aber umprogrammiert werden, ist noch nicht bekannt. «Wir kennen zwar einige der Moleküle, die an der Kommunikation zwischen den Tumorzellen und den Makrophagen beteiligt sind», sagt Kienzler, «aber über den eigentlichen Mechanismus wissen wir noch zu wenig.» Klar: Würden Forschende herausfinden, wie die Umprogrammierung der Makrophagen abläuft, hätte man damit auch Ansätze, diese rückgängig zu machen. Mehr noch: Wäre eine solche Rückprogrammierung bei diesen besonders aggressiven Tumoren erfolgreich, liesse sie sich wahrscheinlich auch für andere Krebsarten therapeutisch nutzen.
Welche Makrophagen-Typen werden nun also von den Tumoren umprogrammiert, und wie genau? Diese Fragen versucht Kienzler zu beantworten. Zum einen ist sie dabei, eine Art Atlas der Oberflächen der Tumor- und Makrophagen-Zellen zu zeichnen. Denn die Kommunikation zwischen verschiedenen Zellen funktioniert über Rezeptoren an deren Oberfläche. Wenn also die Rezeptoren auf den Tumor- und Makrophagen-Oberflächen bekannt sind, liefert das Hinweise auf die Signalisierungswege zwischen den Zellen – und die Möglichkeiten, diese zu blockieren.
Rezeptoren blockieren
Idealerweise will Kienzler jene Rezeptoren identifizieren, die sowohl bei den tumorassoziierten Makrophagen als auch bei den Tumorzellen auf der Oberfläche sitzen. Dann könnte man diese Oberflächenmarker, wie sie in der Fachsprache heissen, mit einem einzigen Wirkstoff auf beiden Zelloberflächen blockieren. Für den häufigsten tödlichen Hirntumor, das Glioblastom, hat die Forscherin diese Kartierung vor kurzem abgeschlossen. Dazu nutzte sie Gewebeproben von Patientinnen und Patienten. Darin untersuchte sie die Oberflächenproteine einzelner Zellen mit einer Methode namens Durchflusszytometrie. So identifizierte sie auf den Oberflächen von Makrophagen- und Tumorzellen je rund 40 Marker. Etwa 20 von ihnen waren auf beiden Zelltypen vorhanden. «Einige davon kannte man bereits und wusste, dass sie auch bei anderen Krebsarten eine Rolle spielen», sagt Kienzler. Andere waren bisher unbekannt. «Damit haben wir nun eine Basis für weitere Untersuchungen, die dann stärker eingrenzen, auf welche Rezeptoren ein neuer Therapieansatz am besten abzielen könnte.»
Jenny Kienzler: Operieren und forschen
Dass jemand gleichwertig in der Klinik und in der Forschung arbeitet, so wie Jenny Kienzler, ist selten – zumindest in Europa. In den USA dagegen ist es anerkannter und wird auch gefördert, dass medizinische Kliniker viel Zeit in die Forschung stecken. Genau das ist laut Kienzler ideal, um in der Hirntumorforschung schneller vorwärtszukommen. «Beides unter einen Hut zu bekommen, ist sicher eine Herausforderung», sagt sie. Sowohl die Neurochirurgie als auch die Forschungstätigkeit sind anspruchsvoll und jede der beiden Rollen eigentlich mehr als ausfüllend. Doch die Kombination anzustreben, lohne sich, sagt Kienzler. Das Hintergrundwissen zu den klinischen Abläufen, die Informationen zum Tumorgewebe aus den Operationen und die Patientengeschichten helfen ihr als Forscherin.
Und weil Kienzler direkt Patientinnen und Patienten behandelt und selbst Neurochirurgin ist, kommt sie – anders als andere Forschende – leichter zu den für die Untersuchungen nötigen Tumorproben. Umgekehrt sei es generell wichtig, dass Neurochirurginnen und -chirurgen in die Hirntumorforschung und in die Entwicklung neuer Therapien miteinbezogen werden, da sie das Gehirn und seine anatomischen Strukturen besser kennen, als Vollzeit-Forschende dies tun. Gerade für neue Behandlungsansätze wie minimalinvasive Verfahren oder innovative Therapien während der Operation sind die Kliniker unerlässlich, weil sie als Einzige direkten Kontakt zum Tumor haben und dadurch gezielte Behandlungen unmittelbar anwenden können. Bei Jenny Kienzler vereinen sich diese beiden Rollen in einer Person.
Zurzeit arbeitet Kienzler daran, mit einer neueren Methode namens CITE-Sequencing die Nukleotidabfolge der RNA dieser Oberflächenproteine für einzelne Zellen zu entschlüsseln. Auf diese Weise hofft sie, verschiedene Zelltypen mit ihren typischen Markern zu identifizieren. Damit hätte man eine eindeutigere Basis für neue Therapien. Allerdings ist diese Methode extrem sensibel. Sie funktioniert nicht wie die meisten anderen Methoden mit Tumorgewebe, das aus Patienten herausoperiert und danach bis zu den Analysen eingefroren wird, sondern nur mit ganz frischen Gewebezellen, wie Kienzler durch ihre ersten Versuche herausgefunden hat. Dies, weil in den herausoperierten Hirntumoren typischerweise 40 bis 50 Prozent der Zellen bereits abgestorben sind. «Das Einfrieren und Wiederauftauen zerstört das Gewebe zusätzlich, sodass danach zu wenige intakte Zellen für die sensitiven Untersuchungen übrig bleiben», erklärt Kienzler. Die einzige Lösung: Frisch herausoperierte Tumorproben müssen direkt aus dem Operationssaal ins Labor gebracht werden, um dort die Untersuchungen zu starten.
Diese Analysen, die nun für das Glioblastom laufen, will Kienzler als Nächstes auch für Hirnmetastasen durchführen. Diese sehen zwar etwas anders aus als hirneigene Tumoren, haben aber einen ganz ähnlichen Effekt auf die lokale Immunantwort und auf die Makrophagen. Und auch hier sind neue Therapieansätze dringend nötig.
Breite Basis für neue Behandlungen
Schon jetzt können Kienzlers Forschungsresultate etwas über die Prognose von Patientinnen und Patienten aussagen. So haben ihre Untersuchungen gezeigt, dass Menschen mit Tumorzellen, die eine bestimmte Sorte Rezeptoren auf der Oberfläche tragen, weniger lange überleben als andere. Ziel ist nun, genauer einzugrenzen, welche Marker sich wie auswirken, als Basis, um unter anderem spezifische Antikörper gegen sie zu entwickeln – und so eine neue Immuntherapie.
Zusätzlich zu diesen Analysen nimmt die Forscherin auch bestimmte tumorassoziierte Botenstoffe genauer unter die Lupe, sogenannte Zytokine. Sie sind Teil der Signalübertragung zwischen Zellen und regulieren unter anderem das Zellwachstum. Wie Kienzler herausgefunden hat, spielen sie ebenfalls eine wichtige Rolle dabei, Makrophagen des Immunsystems anzuziehen und diese zugunsten des Tumors umzuprogrammieren. Bei Versuchen mit Mäusen zeigte sich denn auch: Entzieht man den Zellen die Fähigkeit, solche Botenstoffe zu produzieren, wachsen die Hirntumoren langsamer. Wie genau die Botenstoffe die Makrophagen manipulieren, ist indessen noch unklar. Klar ist aber, dass auch diese Botenstoffe ein vielversprechender möglicher Ansatzpunkt für eine neue Therapie sind.