Wasseruhren und Ewigkeit
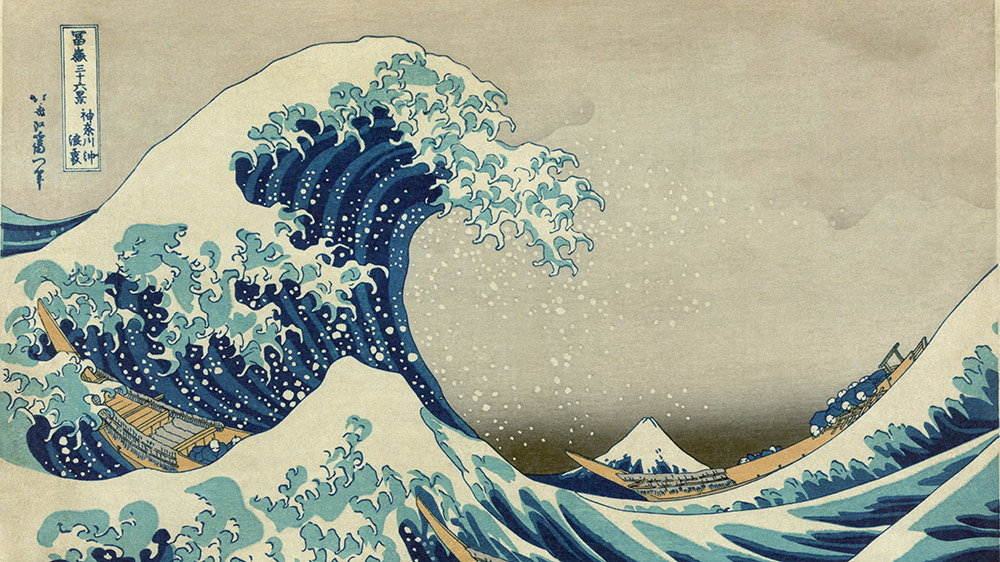
Herr Steineck, was ist Zeit?
Raji C. Steineck: Zeit ermöglicht es uns, Ereignisse aufeinander zu beziehen. Sie erlaubt es, Dinge in verschiedenen Situationen wiederzuerkennen. So gesehen schafft Zeit Konstanz, und sie ermöglicht Unterscheidung.
In Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich mit Fragen der Zeitwahrnehmung. Welche Vorstellung von Zeit dominiert heute in unseren Köpfen?
Heute steht weltweit ein quantitatives Zeitverständnis im Vordergrund. Zeit wird entlang einer Zahlenreihe gemessen und für alle verbindlich festgestellt. Das hängt eng mit den kapitalistischen Produktionsbedingungen zusammen. Unser Wirtschaftssystem ist auf Wachstum ausgerichtet und kennt keine Grenzen. So werden etwa unsere Wochenenden zunehmend ökonomisch kolonialisiert. Natürlich gibt es nach wie vor qualitativ unterschiedliche Zeiten, etwa Jahreszeiten, Ferien und Feste. Solche qualitativen Zeitunterschiede sind für uns als Lebewesen wichtig, das sollten wir nicht vergessen.
Mit der Digitalisierung hat die zeitliche Entgrenzung weiteren Schub erhalten.
Natürlich, die neuen technischen Möglichkeiten erleichtern uns allerdings auch vieles. 1990, in meinem ersten Studienjahr in Japan, war das Hauptkommunikationsmittel mit Europa noch die Post. Die Luftpost brauchte zehn Tage. Wenn man also einen Brief losschickte, bekam man frühestens in drei Wochen eine Antwort. Das Warten darauf war zum Teil sehr quälend. Heute können wir im Minutentakt miteinander kommunizieren, das kann zwar anstrengend sein, es hat aber auch etwas Befreiendes. Das muss man im Blick behalten, wenn man einen sinnvollen Umgang mit den digitalen Medien finden will. Ein einfacher Gut-schlecht-Gegensatz hindert uns daran, zu verstehen, weshalb wir trotzdem alle die Möglichkeiten beschleunigter Kommunikation nutzen. Wir machen uns ja selbst zu Komplizen der Beschleunigung.
Gibt es in der Wahrnehmung von Zeit Unterschiede zwischen Europa und Japan?
Sicher gibt es Differenzen, die gibt es aber bereits innerhalb Europas. Andere warten zu lassen, ist in Süddeutschland und der Schweiz beispielsweise unhöflich, im Rheinland gilt dagegen das «rheinische Viertel», also 15 Minuten nach einem vereinbarten Termin, in denen man nicht in Ungnade fällt, in bestimmten Ländern kann man sich noch deutlich mehr Zeit lassen. Das hängt natürlich auch mit der jeweiligen Infrastruktur zusammen. Zeitliche Verbindlichkeit wird auch in Japan grossgeschrieben. Das Land gilt in der Moderne als Kultur der Pünktlichkeit. Man erscheint auf die Minute genau; ausser in Tokyo, wo alle wissen, dass das unmöglich ist, weil immer etwas dazwischenkommen kann. Generell werden die Menschen aber dazu erzogen, an eine wichtige Verabredung eher eine Viertel Stunde zu früh zu kommen, damit auf jeden Fall rechtzeitig begonnen werden kann. Die auffällige Pünktlichkeit ist in Japan allerdings eine jüngere Tradition. Sie musste den Leuten erst einmal eingeprügelt werden. Da hat eine massive Transformation der Gesellschaft stattgefunden.
Wie sind Sie Zeitforscher geworden?
In meiner Dissertation habe ich mich mit europäischen Mystikern und japanischen Zen-Buddhisten im Mittelalter beschäftigt. Dabei ging es um Wahrheits- und Erkenntnisansprüche, die auch im Verhältnis zu ganz bestimmten Zeitvorstellungen stehen: Sowohl in der christlichen Mystik als auch im Zen-Buddhismus gibt es die Tendenz, die Gegenwart als ständig sich erneuernde Ewigkeit zu sehen.
Das wäre dann quasi ein zeitloser Zustand.
Bei Meister Eckhart (1260 bis 1328) gibt es eine schöne Stelle, wo er die Schöpfungsgeschichte der lateinischen Bibel interpretiert. Er legt dabei viel Wert darauf, dass Gott «in initio», also «im» Anfang die Welt schafft und nicht «am» Anfang wie in anderen Auslegungen. Letztere entsprechen einem linearen Zeitkonzept. Eckhart betont nun aber, Gott schaffe die Welt im Anfang und in diesem Anfang schaffe er sie immer wieder neu. Das Jetzt wird sozusagen zum Augenblick der Schöpfung. Im Buddhismus existiert der Gedanke auch, dass der Augenblick unmittelbar mit der Ewigkeit verbunden ist. Er steht dort im Widerspruch zu einer linearen Vorstellung von Karma – der Vorstellung also, dass das, was man tut, einen entscheidenden Einfluss darauf hat, wie es einem in der Zukunft ergehen und wie man in den kommenden Phasen des Zyklus von Geburt und Tod leben wird. Die Auseinandersetzung mit diesen Themen war für mich das Einstiegstor, mich mit Fragen der Zeit zu -beschäftigen.
Nun untersuchen Sie in einem vom Forschungsrat der EU unterstützten Projekt die Zeitwahrnehmung im japanischen Mittelalter, konkreter den Zeitraum von 1200 bis 1500. Wie wurde Zeit damals wahrgenommen?
Das japanische Mittelalter war eine unglaublich dynamische Zeit. Geprägt war es von Kämpfen zwischen diversen Machtzentren: verschiedenen Linien des Kaiserhauses, führenden Familien des Hofadels sowie Vertretern des Krieger-adels. Gleichzeitig blühten das kulturelle Leben und die wirtschaftliche Produktivität auf. Damals wie heute jonglierten die Menschen kompetent mit ganz unterschiedlichen Zeit-konzepten.
Zum Beispiel?
Der zeitliche Tagesablauf am Kaiserhof etwa unterlag strengen Vorschriften. In den buddhistischen Tempeln wiederum wurde das Leben den Klosterregeln entsprechend organisiert. Festgelegt wurde etwa, wann und wie lange die Mönche zu meditieren hatten. Auch die damals aufkeimende Finanzwirtschaft hatte bezüglich Abgaben, Zinsen und Steuern ihr eigene zeitliche Ordnung. Diese Ordnungen konnten zuweilen miteinander in Konflikt geraten.

Wie sahen solche Zeitkonflikte aus?
Der buddhistische Abt Dogen (1200 bis 1253) wies etwa seinen Küchenmeister an, Spenden für eine Mittagsmahlzeit sofort in den Kauf von Reis zu investieren. Geld, das übrig blieb, musste unverzüglich zurückgegeben werden. Das Ausleihen von Reis aus dem Klostervorrat gegen Zins war strikt untersagt. Dogen wirkte so einer Ökonomisierung des Klosterlebens entgegen. Die Wirtschaft sollte keine Überhand über die Religion gewinnen. Wie dieses Beispiel zeigt, gab es bereits damals konkurrierende Zeitperspektiven, das macht das Thema für mich interessant. In unserem EU-Forschungsprojekt wollen wir nun Zeitvorstellungen in den gesellschaftlichen Bereichen Kloster, Kaiserhof und Markt anhand ganz unterschiedlicher Quellen detailliert weiter erforschen. Genauso werden wir uns anhand medizinischer und religiöser Literatur mit dem Verhältnis von Zeit und Körper auseinandersetzen.
Wie wurde im japanischen Mittelalter Zeit konkret gemessen?
Der Kaiserhof verfügte seit dem Altertum über Wasseruhren, damit wurden gleichförmig Stunden gemessen. Mit der Zeit fanden diese auch in grösseren Klöstern Verwendung. Diese Art der Zeitmessung konkurrierte mit natürlichen Zeitanzeigen, etwa dem Sonnenstand. Der Vorteil der Wasseruhren war, dass sich damit auch nachts und bei bedecktem Himmel die Zeit feststellen liess.
Dafür gab es dann Hofbeamte, die die Zeit massen?
Genau, und gegen Ende des Altertums gab es mehr und mehr Wasseruhren. In den Residenzstädten wurde die Zeit auch über Trommel- und Glockenschläge bekannt gegeben. Es gab damals zudem einen reichsweit gültigen Kalender. Eine der wichtigsten Aufgaben der politischen Machthaber war es, diesen Kalender festzusetzen und zu verkünden. Damit wurde – auf der Ebene von Jahren, Monaten und Tagen – das gesellschaftliche Handeln koordiniert.
Das japanische Mittelalter liegt in weiter Vergangenheit. Was bringt uns die Erforschung der damaligen Zeitwahrnehmung heute?
Ziel unserer Forschung ist es, ein nuanciertes Bild der unterschiedlichen Zeitkonzepte im mittelalterlichen Japan zu zeichnen. Wenn wir heute über die Thematik der Zeitgestaltung reden, ist es hilfreich, zu wissen, dass manche unserer Probleme nicht so neu sind, wie wir meinen. Es gehört vielleicht einfach zu einer Gesellschaft, dass sie unterschiedliche Zeitgestaltungen und -modelle austariert. Damit wird auch verhindert, dass ein einziges Zeitmodell das Leben vollständig bestimmt. Wenn beispielsweise allein religiöse Zeitvorstellungen den Takt des Alltags vorgeben, kann das ziemlich unerfreulich sein.
So gesehen spiegeln sich viele Zeitfragen, die man sich im mittelalterlichen Japan gestellt hat, in der Gegenwart?
Eine Systemzeit, die Vorgaben machte, wonach sich die Menschen zu richten haben, gab es jedenfalls schon damals. Allerdings orientierte man sich im japanischen Mittelalter auf einer zeitlichen Skala von Stunden, Tagen, Monaten und Jahren, nicht wie heute von Minuten und Sekunden. Mit der quantitativen Beschleunigung und zunehmend minutiösen Zeiteinteilung, die wir heute erleben, gehen auch Veränderungen in der Lebensqualität einher. Aber zeitliche Komplexität ist letztlich kein Alleinstellungsmerkmal der Moderne, wie das immer wieder behauptet wurde.
Sondern?
Wir sollten uns vom oft gezeichneten Bild verabschieden, dass das Leben vor der Moderne harmonisch und im Einklang mit der Natur gewesen sei. Das stimmt für das japanische Mittelalter zumindest nicht. Sicher war die Abstimmung mit natürlichen Zyklen für die Landwirtschaft wichtig und fand dort auch statt. Aber auch die Bauern konnten nicht nur auf die Natur schauen, weil sie etwa Abgaben leisten und zeitabhängige Zinsen zahlen mussten. Das Bild einer vormodernen Zeitidylle trifft nicht zu.