Nachhaltige Forschungsförderung

Das Förderprogramm TRANSFORM zielt darauf ab, dass an der UZH neue Organisationsstrukturen in zukunftsweisenden Forschungsbereichen aufgebaut werden können. Die geförderten Strukturen sind prinzipiell interdisziplinär ausgerichtet. Eine Anforderung an die geförderten Projekte ist, dass die Strukturen nach der zentralen Anschubfinanzierung durch fakultäre Mittel weiter finanziert werden. So ist sichergestellt, dass die Strukturbildung nachhaltig erfolgt.
In den kommenden vier Jahren werden drei Projekte mit TRANSFORM-Fördergeldern unterstützt: Für den Aufbau eines Instituts für Archäologie, Klassische Philologie und Altertumswissenschaften (IAKA) an der Philosophischen Fakultät werden 1,8 Mio. Franken bereitgestellt, das neue interfakultäre Zentrum für Research Synthesis erhält eine Million Franken. In der Medizin soll ein neues Center for Engineered Immunotherapy die Translation von Forschungsergebnissen in die klinische Anwendung erleichtern. Dafür erhält das Center in den kommenden vier Jahren 0,75 Mio. Franken.
Neue Wege in den Altertumswissenschaften

Mit modernsten Technologien interdisziplinär die Welt der griechisch-römischen und anderen früheren Kulturen erforschen: Das ist unter anderem das Ziel des neuen Instituts für Archäologie, Klassische Philologie und Altertumswissenschaften (IAKA). Das neu geplante Institut basiert auf einem Zusammenschluss des Instituts für Archäologie, des Seminars für Griechische und Lateinische Philologie der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit, sowie einer engen Anbindung der drei Lehrstühle aus dem Bereich Alte Geschichte des Historischen Seminars.
Zu bereits bestehenden Professuren sind im neuen Institut drei weitere Assistenzprofessuren mit Tenure Track geplant, die zur inhaltlichen Profilierung des IAKA beitragen werden. So ist unter anderem eine neue Professur für Mensch und Umwelt in der antiken Welt vorgesehen. Denn der Blick auf Entwicklungen in früheren Gesellschaften helfe dabei, ähnliche Entwicklungen in der heutigen Zeit besser zu verstehen, sagt Archäologie-Professorin Corinna Reinhardt, die die Gründung des Instituts federführend gestaltet. «Wir können mit einem methodisch fundierten wissenschaftlichen Blick versuchen zu rekonstruieren, was passiert ist.» Etwa, wie resilient Gesellschaften gegenüber Naturereignissen sind und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
Digitale Methoden weiterentwickeln
Sowohl Reinhardt wie auch Felix K. Maier, dessen Lehrstuhl für Alte Geschichte künftig einerseits eng mit dem IAKA verbunden sein soll, andererseits auch weiterhin im Historischen Seminars beheimatet ist, nutzen in ihrer Forschung bereits jetzt intensiv digitale Methoden wie KI und 3D-Visualisierungen. Am IAKA sollen diese Methoden erweitert und weiterentwickelt werden. Dafür wird eigens eine Oberassistenzstelle geschaffen, um in diesem aufstrebenden Feld gezielt Nachwuchswissenschaftler:innen zu fördern.
«Was das Institut – auch international – auszeichnet, ist, dass wir in der Forschung neue, unkonventionelle Wege gehen werden», sagt Maier. Damit meint er nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Fächern wie der klassischen Archäologie, antiken Geschichte oder klassischen Philologie, die im angelsächsischen Raum bereits sehr stark ausgeprägt ist. «Wir werden stark mit Disziplinen wie Computerlinguistik, Psychologie, Geologie oder Klimawissenschaften zusammenarbeiten», so Maier. In seinem Forschungsprojekt «Re-Experiencing History» arbeitet er etwa mit Computerlinguisten zusammen und setzt generative künstliche Intelligenz ein, um historische Szenen als Bilder oder kurze Video-Sequenzen zu visualisieren. «Wenn wir historische Szenen als tatsächliche Bilder vor uns haben, dann kommen wir nochmals auf ganz andere Ideen und Fragestellungen. Das ist für uns sehr fruchtbar.»
Wissenschaftliche Qualität stärken
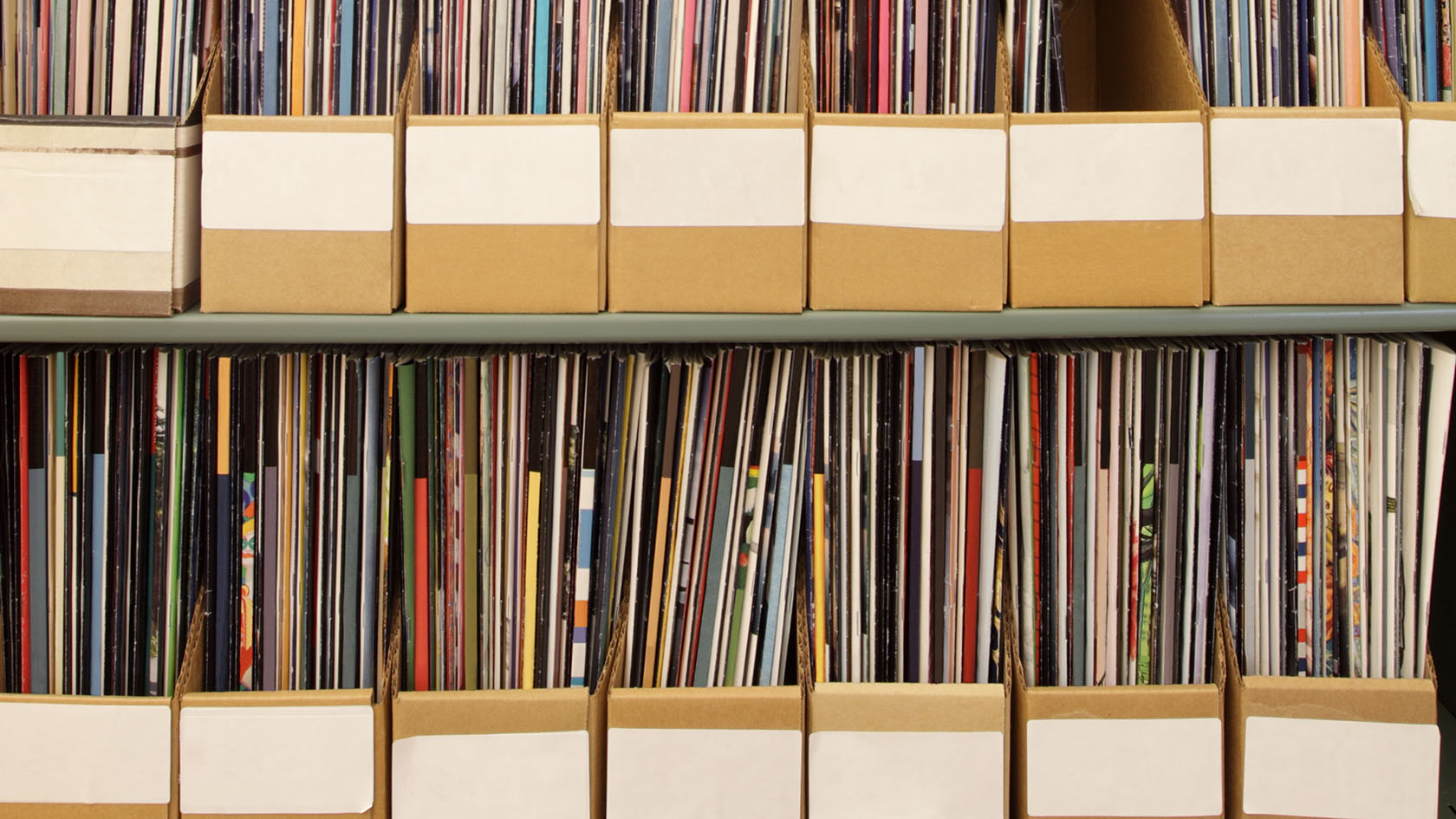
Die wissenschaftliche Qualität und damit verbunden die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse stehen im Fokus des 2018 an der UZH gegründeten Kompetenzzentrums Center for Reproducible Science (CRS). Nun soll das CRS in ein neues Zentrum für Reproduzierbarkeit und Forschungssynthese überführt und verstetigt werden. «Wir wollen damit die beiden Themen Reproduzierbarkeit und Forschungssynthese zusammenbringen», sagt Leonhard Held, Professor für Biostatistik an der UZH und Gründungsdirektor des CRS.
Beide Ansätze sind wichtig, um die Qualität und Validität von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu beurteilen. Forschungssynthesen dienen dazu, durch Zusammenfassung und Kombination von bestehenden Studien den Forschungsstand in einem Themenbereich zu bewerten und einzuordnen. Jedoch fehlten häufig die Methoden, um überhaupt wissenschaftliche Ergebnisse miteinander verbinden zu können, führt CRS-Geschäftsführer Fabio Molo aus. «Insbesondere, wenn die einzelnen Studien verschiedene Datentypen oder unterschiedlichen Methodologien verwenden.»
Spreu vom Weizen trennen
Heute werden jedoch vermehrt nicht nur Studien, sondern auch die ihnen zugrundeliegenden Daten veröffentlicht. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, Studien zu vergleichen und zu kombinieren: «Statt lediglich die Ergebnisse aus den Studien zusammenzutragen und auszuwerten – wie in einer klassischen Meta-Analyse – greifen wir direkt auf die Rohdaten zurück», so Held. Die Forschung am neuen Zentrum soll Methoden entwickeln, um Auswertungen über nicht einheitliche Rohdaten zu ermöglichen. Ein Beispiel ist die sogenannte Individual Patient Data Meta-Analysis in der Medizin, die für die Synthese der Ergebnisse direkt auf die zu Grunde liegenden Patientendaten zurückgreift.
Ein zweiter Schwerpunkt am Zentrum ist die Forschung zu Methoden, um die Validität oder Reproduzierbarkeit der Ergebnisse einzelner Studien besser beurteilen zu können. «Wir müssen besser in der Lage sein, die Spreu vom Weizen zu trennen», erklärt Held. Der hohe Publikationsdruck führt dazu, dass weltweit immer mehr Studien von zweifelhaftem wissenschaftlichem Wert veröffentlicht werden. «Wir wollen die Methodik entwickeln, mit der man die Qualität wissenschaftlicher Evidenz besser beurteilen kann», so Molo.
Diese Verfahren sollen allen interessierten Forschenden an der UZH zugutekommen. Denn obwohl das neue Zentrum an der Medizinischen Fakultät angesiedelt ist, ist das Thema «wahrhaft interdisziplinär», wie Held betont. «Da häufig die gleichen Methoden unabhängig von der Disziplin angewendet werden, können die Disziplinen auch voneinander lernen.» Die bereits bestehenden Kurse des CRS für Nachwuchsforschende in allen Disziplinen sollen durch das neue Zentrum weitergeführt werden.
Vom Labor in die Anwendung

Die Immuntherapie ist ein vielversprechender Ansatz, unterschiedlichste Krankheiten von Krebs bis zu Auto-Immunerkrankungen effizient zu bekämpfen. Es handelt sich dabei um verschiedene Methoden, die das körpereigene Immunsystem nutzen, um Tumore zu bekämpfen, die es natürlicherweise nicht ausreichend effizient angreift. «In der Forschung zur Immuntherapie sind wir an der UZH sehr gut aufgestellt», sagt Markus Manz, Professor für Hämatologie an der UZH und Direktor der Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie am Universitätsspital. «Wenn es aber darum geht, die im Labor erzielten Erfolge in klinische Versuche umzusetzen, stossen wir an Grenzen.»
Diesen Engpass soll das neue Center for Engineered Immunotherapy (CEI) mit einer Assistenzprofessur beheben, die spezifisch auf die Übertragung von Forschungsergebnissen in anwendbare Therapien ausgerichtet ist. «Bevor eine Entdeckung im Labor in eine erste klinische Studie überführt werden kann, braucht es sehr viel Vorbereitungsarbeit», erklärt Manz. Die Professur soll sicherstellen, dass dafür Ressourcen zur Verfügung stehen. Ziel ist es laut Manz, «einen verlässlichen und gut standardisierten Pfad aufzubauen, mit dem wir neue Therapieansätze einfacher in die Klinik bringen.»
Synergiepotenziale besser erkennen
Zudem wird das CEI auch die bereits bestehenden vielfältigen Forschungsaktivitäten zur Immuntherapie an der UZH bündeln und den Austausch unter den Forschenden verbessern. Denn oft können Technologien, die für eine bestimmte Krankheit entwickelt wurden, auch in ganz anderen Gebieten angewendet werden. «Es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass bestimmte in der Krebsforschung entwickelte Therapien äusserst effizient sind bei bestimmten Auto-Immunerkrankungen», erklärt Manz. Das CEI soll Strukturen schaffen, die dazu führen, solche Potenziale besser zu erkennen und zu nutzen.
Inhaltlich fokussiert die Forschung am CEI auf verschiedene immunologische Methoden zur Bekämpfung von Tumoren. Zum einen werden Immunzellen (wie z.B. T-Zellen) genetisch so verändert, dass sie Krebszellen mittels Rezeptoren erkennen. Kommt es zum Kontakt mit den Tumorzellen, können sie diese zum Absterben bringen. Die Forschung am CEI zielt darauf ab, die Methoden für die genetische Veränderung der Zellen im Labor weniger aufwändig und auch kostengünstiger machen. Im besten Fall kann dies direkt im Körper der Patient:innen passieren.
Zum anderen sollen neue Moleküle entwickelt und untersucht werden, die im Patienten Immunzellen effektiv gegen Krebs aktivieren können. Diese Moleküle wirken, ohne dass die Immunzellen genetisch verändert werden müssen, was das Potential hat, die Therapien wirksamer, sicherer und langfristig mehr Patient:innen zugängig zu machen.