Denken mit Händen und Füssen
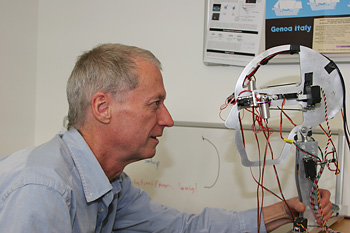
unipublic: Herr Pfeifer, in Ihren Labor-Räumen am Institut für Informatik sieht es ein wenig aus wie in einem Zoo: Da gibt es die verschiedensten Roboter-Tiere zu besichtigen. Die einen können tanzen, andere können greifen, wieder andere krabbeln, tasten und umheräugen. Was erzählt Ihnen diese vielgestaltige Roboter-Familie über das Phänomen der Intelligenz?
Rolf Pfeifer: Sie erzählt mir, dass Intelligenz kein Programm ist, das in Gehirnen abläuft, sondern damit zu tun hat, wie körperhafte Wesen mit ihrer Umwelt interagieren. Je vielfältiger diese Interaktionsmöglichkeiten, desto höher die Intelligenz. Intelligenz ohne Körper macht keinen Sinn. Körper brauchen Intelligenz, um Gegebenheiten in wechselnden Umwelten für sich ausnutzen zu können. Um mit einer Umwelt zu interagieren, braucht man einen Körper. Nur ein Körper kann durch Interaktion mit der Umwelt die für das Gehirn relevante Information erzeugen. Die Intelligenz eines Wesens ist deshalb durch seine spezifische Körpergestalt - den Bewegungsapparat, die Sinnesleistung - geprägt. Die menschliche Intelligenz beispielsweise ist in der spezifisch menschlichen Körperlichkeit verankert. Man nennt diese Verankerung «Embodiment». Unsere kognitiven Fähigkeiten wären anders beschaffen, wenn wir, statt aufrecht einherzuschreiten, auf Tausendfüsslerbeinchen am Boden herumwuseln und unsere Umwelt in erster Linie über den Tastsinn wahrnehmen würden. Unsere Art zu denken ist geprägt von der Funktionsweise und Gestalt unserer Sinnesorgane, unserer Muskeln, unserer Gelenke, unserer Gliedmassen.
Wir denken also auch mit den Armen und Beinen?
So ist es. Das klingt ungewohnt, weil wir in der Tradition von Platon und Descartes vom Primat des Denkens über das materielle körperliche Dasein ausgehen. Der Körper erscheint in dieser Denktradition bloss als materielle Hülle des Geistes, bestenfalls als Apparat, der Befehle ausführt, die er vom Hirn empfängt. Die Computer-Metapher, die heute unsere Vorstellung davon bestimmt, was Denken ist, passt hervorragend in diese Tradition. Wir stellen uns vor, Intelligenz sei nur eine Frage der Rechenkapazität. Ich glaube, das ist eine viel zu enge Sicht der Dinge. Es wird Zeit, dass wir uns von der Computer-Metapher lösen.

Sie bauen Roboter, um zu zeigen, dass Menschen nicht nach dem Modell computergesteuerter Maschinen funktionieren?
Das klingt vielleicht paradox, aber so könnte man es ausdrücken. Ich zeige mit meinen Robotern, dass intelligentes Verhalten zu einem wesentlich geringeren Teil durch zentrale Steuerung zustande kommt als man annehmen könnte.
Gleichzeitig sind Sie, als prominenter Verfechter der sogenannten «Neuen künstlichen Intelligenz» daran, die Robotik selbst zu revolutionieren.
Die traditionelle Robotik hat sich viel zu einseitig mit der Programmierung beschäftigt. Ich lege im Gegensatz dazu mein Hauptaugenmerk auf die Roboter-Physis: das Zusammenspiel von materieller Beschaffenheit, Mechanik und Sensomotorik. Ich verstehe einen Roboter, so einfach er auch konstruiert sein mag, als komplexes dynamisches System, das nicht nur nach einem simplen Input-Output-Schema Befehle ausführt, sondern Kraft seiner physikalischen Beschaffenheit auf spezifische Weise mit seiner Umwelt interagiert. Nutzt man die natürliche Dynamik von Materialien, kann man Roboter so bauen, dass sie sich mit minimalem Steuerungsaufwand geschickter durch den Raum bewegen als ein mit Elektronik vollgestopfter, starrer Metallkoloss, dessen Bewegungen bis ins letzte Detail berechnet werden. Dank Federkonstruktion an seinen vier Beinen und flexiblem Rückgrad kann beispielsweise der Leichtmetallhund «Puppy» auf wohlkoordinierte Weise umherrennen, ohne dass ein zentraler Rechner die Bewegungen überwacht.

Ist das Hirn als Zentralorgan überbewertet? Sind wir vorwiegend reflexgesteuert?
Das Hirn erbringt zweifellos unermesslich komplexe Leistungen. Trotzdem sind wir in viel geringerem Masse kopfgesteuert als man gemeinhin annimmt. Der Geh-Vorgang beispielsweise funktioniert über weite Strecken mit minimaler Hirnbeteiligung; wir kommen durch Ausnutzung natürlicher Pendelbewegungen und der Materialeigenschaften des Muskel-Sehnensystems voran. Unser Hirn wäre völlig überfordert, wenn es alle unsere Aktionen unter Kontrolle halten müsste.
Ihre Roboter-Forschung zeigt, dass gerade Leistungen, die uns besonders leicht erscheinen, für Roboter besonders schwierig auszuführen sind – und umgekehrt. Ist das ein Hinweis darauf, dass wir falsche Vorstellungen davon haben, was intelligentes Verhalten ist?
Ja, wir unterschätzen den Komplexitätsgrad alltäglicher Verrichtungen wie beispielsweise das Zusammenfalten einer Zeitung, das Zubereiten einer Mahlzeit oder das Wiedererkennen eines bekannten Gesichtes. Im Gegenzug überschätzen wir die Komplexität abstrakter Rechenleistungen. Als der Schachcomputer «Deep Blue» 1997 den damaligen Schachweltmeister Gary Kasparow schlug, sprachen manche Intelligenzforscher von einer Deklassierung der menschlichen Intelligenz durch den Computer. Ich sehe das anders: «Deep Blue» verfügt über die Kapazität, um eine riesige Anzahl von Spielvarianten durchzurechnen. Eine Tasse Kaffee an den Mund zu führen ist jedoch ein wesentlich komplexerer Vorgang als das Gewinnen einer Schachpartie oder das Lösen einer mathematischen Gleichung - und erfordert entsprechend wesentlich mehr Intelligenz. Verschiedene Sinnesorgane, die Muskeln, der Bewegungsapparat müssen dabei verlässlich zusammenspielen. Wie kompliziert dies ist, merkt man erst, wenn man einen Roboter dazu zu bringen muss, einen solchen Vorgang auszuführen. Aber das schätze ich ja so am Umgang mit Robotern: Sie lenken die Aufmerksamkeit auf scheinbare Selbstverständlichkeiten, die man sonst völlig übersehen würde.

Weshalb erachten Sie es eigentlich als zulässig, von der künstlichen Intelligenz der Roboter auf menschliche Intelligenz zu schliessen - wo doch die Physis eines Roboters eine ganz andere ist als die eines Menschen?
Die Frage ist berechtigt. Tatsächlich wird ein Roboter aufgrund seiner sensomotorischen Eigenheiten nie auf dieselbe Weise mit der Umwelt interagieren wie ein Mensch. Statt Augen hat er vielleicht eine Kamera. Beim Heben der Tasse tritt sein Bewegungsapparat auf andere Weise in Aktion als bei mir. Er hat nicht dieselben Tastsensoren wie ich. Entsprechend wird er dieselbe Tasse immer anders erleben als ich, Tassen überhaupt werden sich für ihn anders anfühlen. Dennoch gibt es Parallelen: Das Prinzip, nach dem der Roboter etwas über den Umgang mit Tassen lernen kann ist dasselbe wie beim Menschen: Durchs wiederholte Hochheben und Ansehen von Tassen – durch sensomotorischen Stimulation also – kann er ein Konzept von Tassen im Allgemeinen bilden: Er stellt Korrelationen zwischen Form, Oberflächenbeschaffenheit oder Gewicht her, und mit der Zeit kommen crossmodale Assoziationen zwischen den verschiedenen Sinneskanälen zustande. Der Roboter kann dann beispielsweise allein aufgrund des visuellen Eindrucks einer Tasse das Gewicht derselben abschätzen. Das Grundmuster eines solchen Lernprozesses ist bei Robotern dasselbe wie bei Menschen.
Herr Pfeifer, Sie sind einer der kreativsten Forscher der modernen Robotik. Was stimuliert Sie selbst zu Ihren wissenschaftlichen Höhenflügen?
Vielleicht zweierlei: erstens ist da das Überraschungspotential, das der Roboterbau birgt. Das Experimentieren mit Robotern führt immer wieder zu unvorhergesehenen Ergebnissen, die man zunächst nicht einordnen kann. Das zwingt einen auf Seitenpfade abseits gängiger Erklärungsmuster. Sehr wichtig ist für mich zweitens die Vernetzung mit anderen Fachgebieten: der Beschäftigung mit Philosophie, Psychologie, Biologie oder den Neurowissenschaften verdanke ich zahlreiche Impulse.