«Strassenkinder» in Zürich?

Der Begriff der «Strassenkinder» hatte den Weg insbesondere über die Medien in die Wissenschaft gefunden. Die bisherige Forschung hatte gezeigt, dass sich das Phänomen in Europa anders präsentiert als etwa in Entwicklungsländern: Europäische «Strassenkinder» sind meist über 12 Jahre alt, stellen kein reines Armutsphänomen dar und das Leben auf der Strasse findet oft nur in Phasen statt. Gemeinsam ist aber allen «Strassenkindern», dass der öffentliche Raum den Lebensmittelpunkt und die wesentlichste Sozialisationsinstanz darstellt.
Nicht nur die «störenden» Jugendlichen
Was die Situation in der Schweiz anbelangt, so lagen bisher neben vereinzelten Medienberichten drei Diplomarbeiten vor. Die Medien interessierten sich insbesondere für auffällige und bisweilen als störend empfundene Jugendliche, in Zürich etwa in der Nähe des Hauptbahnhofes oder am Zürichsee. Diese Gruppe von «Strassenkindern» ist gemäss der Forschungsstelle Sozialpädagogik zwar die «sichtbarste, jedoch vermutlich nicht die einzige in Zürich».
Die bisherigen Diplomarbeiten erlaubten ebenfalls keine verlässliche Aussage über die Verbreitung des Phänomens. Zumindest für die Stadt Zürich wollte dies die nun vorliegende Studie «Kinder und Jugendliche auf der Strasse? Pilotstudie in der Stadt Zürich» ändern. Sie entstand unter der Leitung von Dr. Thomas Gabriel von der Sozialpädagogischen Forschungsstelle am Pädagogischen Institut der Universität Zürich. Auftraggeber der Untersuchung war die Jugendseelsorge Zürich (Katholische Arbeitsstelle für Jugendarbeit und Jugendberatung im Kanton Zürich).
Öffentliche Orte als Strasse
Was aber soll in Zürich unter «Strassenkindern» verstanden werden? Die Definition wurde eng gezogen. Gemeint waren Kinder und Jugendliche, welche zumindest einen grossen Teil ihrer Zeit «auf der Strasse» (an öffentlichen Orten) verbringen, sich von gesellschaftlichen Instanzen (Familie, Schule, usw.) abgekehrt haben und über Nacht nicht regelmässig nach Hause gehen - ohne ihre Eltern wissen zu lassen, wo sie sich aufhalten.
Erhoben werden konnten allerdings nur Jugendliche, welche noch einen zumindest minimalen Kontakt zu Hilfsinstitutionen aufwiesen, da die Datenerhebung über Fachpersonen solcher Institutionen vorgenommen wurde.
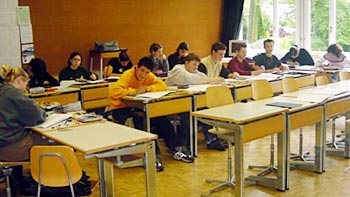
Abschied von der Schule
64 «Kinder und Jugendliche auf der Strasse» zählten die Fachleute im Erhebungszeitraum Januar/Februar 2004. Mit einem Altersdurchschnitt von 17 Jahren sind es eher Jugendliche denn Kinder, die Jüngsten sind 13-jährig. Eine Mehrheit der erfassten Personen ist männlich (61%) und stammt aus der Stadt oder dem Kanton Zürich. Von der Nationalität her handelt es sich mehrheitlich um Personen aus der Schweiz (42%), aus dem Balkan (17%) und aus Südeuropa (12%). Von den noch schulpflichtigen Jugendlichen besuchen lediglich fünf Prozent regelmässig die Schule. Gemäss der Studie bestätigt sich somit die Annahme, dass sich Strassenkinder «von der Sozialisationsinstanz Schule weitgehend abgewandt haben».

Probleme mit Familie und Gewalt
Warum aber haben diese Jugendlichen ihren Lebensmittelpunkt in den öffentlichen Raum verlegt? Da die Kinder und Jugendlichen nicht selber befragt wurden, kann die Studie nur die Einschätzung der befragten Fachpersonen aus den Institutionen wiedergeben. Diese sehen die Problemlagen unter anderem in der Familie: Konflikte mit den Eltern, Gewalt oder auch der «Rauswurf» von zuhause. Als weitere Problemfelderwurden Gewalterfahrungen (erlebte wie ausgeübte) und Drogenprobleme genannt. Als belastend angegeben wurden aber auch Probleme im Zusammenhang mit Migration: Kulturkonflikte, Asylsuche und Kriegstraumata. In der ebenfalls mehrmals genannten Kategorie «Wohnlage» erscheinen zudem Probleme etwa mit dem Leben in einem Heim oder schlicht die Aussage «keine Wohnung».
Qualitative Studie wird folgen
Für Norbert Hänsli von der Jugendseelsorge Zürich hat die Studie gezeigt, dass Jugendliche auf der Strasse «zwar kein Massenphänomen, aber doch ein Phänomen ist, das es auch in Zürich gibt». Die Grössenordnung der Betroffenen sei vergleichbar mit Grossstädten in Deutschland, wobei bei den 64 Personen zusätzlich von einer Dunkelziffer auszugehen sei. Um die Ergebnisse der Studie zu diskutieren, hatte am 6. Dezember bereits eine Fachtagung für soziale Institutionen stattgefunden. Dabei war seitens der Sozialpädagogischen Forschungsstelle auch angekündigt worden, dass eine qualitative Studie der Pilotstudie folgen wird.