Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch

Im klassischen Modell der internationalen Beziehungen werden nur Staaten repräsentiert. Demokratie als direktes Bürgerhandeln ist nicht vorgesehen. Beförderung der Demokratie in den internationalen Beziehungen bedeutet in diesem Fall, dass die Regierungen, die ihr Land auf dem internationalen Parkett vertreten, gegenüber ihren Bürgern stärker rechenschaftspflichtig werden und deren Präferenzen angemessener repräsentieren sollen.
Klingt minimalistisch, wäre aber in vielen Fällen mit einer erheblichen Demokratisierung der internationalen Beziehungen verbunden. Es mag gute Gründe geben, bestimmten Ländern in internationalen Gremien mehr Stimmengewicht zu geben. Dies ist aber nicht mit einer Demokratisierung verbunden, wenn diese Länder diktatorisch regiert werden. «One dictator, one vote» ist noch keine Demokratie.
Die internationalen Beziehungen sind seit der Mitte des 20. Jahrhunderts zunehmend von einer individualistischen Wende gekennzeichnet, die in den kosmopolitischen Philosophien der Aufklärung vorweggenommen wurde. Damit ist zunächst gemeint, dass dem Individuum als Rechtssubjekt des internationalen Rechts mehr Bedeutung zukommt. Menschenrechtskonventionen, internationales Strafrecht, humanitäres Völkerrecht und dergleichen geben dem Individuum einen Status als Adressat von Rechten. Im europäischen Menschenrechtssystem können Individuen die Staaten sogar einklagen. Die Menschen bleiben aber passiv, was die Gesetzgebung des internationalen Rechts durch direkte Wahrnehmung politischer Rechte betrifft.
Die starke technische, wirtschaftliche und soziale Verflechtung, die wir in heutiger Zeit beobachten, hat zur Konsequenz, dass innere Entscheidungen von Staaten mehr Auswirkungen auf die «Aussenwelt» haben und unbeabsichtigte aggregative Resultate erzielen. Zudem sehen sich Staaten durch globalen oder regionalen Problemdruck gezwungen, vermehrt gemeinsam verbindlich zu handeln, in Gremien wie der G20, WTO, Mercosur, ASEAN, EU, etc.
Durch diese Situation der «Multilateralisierung» wird das System der Abschottung der Demokratie im Gehege des Einzelstaates in Frage gestellt, ohne dass aber ein besseres Modell «prêt-à-porter» zur Verfügung stehen würde. Die demokratische Qualität der genannten Gremien wird stark angezweifelt. Es steht aber nicht fest, dass die nationalstaatliche Demokratie das Mass aller demokratischen Systeme sein soll. Die Demokratie und ihre Theorie haben ihre Ursprünge im Stadtstaat und in der kleinen überschaubaren Stammesgemeinschaft. Es gab und gibt die Demokratie auch in der Gemeinde, und würde man deren Struktur als Massstab nehmen, wäre der Nationalstaat gar nicht demokratiefähig.
Die Demokratietheorie hat meist auf das Innere des Volkes, nicht aber auf die Beziehungen zwischen den Völkern reflektiert. Es ist aber nicht plausibel, dass Völker in sich gekehrte, solipsistische Entitäten sind oder sein sollen. Menschen und die von ihnen gebildeten Familien, Firmen und NGOs sind mobil und transnational aufgestellt, und die Völker selbst sind miteinander vernetzt.
An welchen Kriterien sollen wir uns also orientieren, um das Modell einer legitimen Demokratie unter Völkern zu entwerfen? Das Rad muss hier nicht unbedingt neu erfunden werden. Die Schweiz ist zum Beispiel eine Demokratie mit mehrstufig organisierten Völkern. Die multilateralen Organisationen wie die EU sind aber um einiges komplexer. Das wird schon nur daran ersichtlich, dass es in der Schweiz 4 und in der EU 23 offizielle Sprachen gibt. Ein «copy-paste» des Schweizer Modells auf die EU ist nicht möglich, aber zahlreiche Strukturelemente sind trotzdem ähnlich.l
Wie gesagt ist die innere Demokratisierung der Staaten eine Ausgangsbedingung der Demokratisierung der internationalen Beziehungen. Die EU ist eine Organisation, die dies zur Bedingung stellt. Nur demokratische Staaten können Mitglied werden. Da Demokratie aber auf Rechtsstaatlichkeit beruht, sollten internationale Organisationen, die zwar nicht selbst aus lauter Demokratien bestehen, aber im Inneren ihrer Mitgliedstaaten Rechtsstaatlichkeit fördern (Beispiel WTO), nicht im Namen eines demokratischen Reinheitsgebots abgelehnt werden. Rom wurde nicht an einem Tag gebaut und die internationalen Beziehungen werden nicht durch einen «big bang» demokratisiert.
Damit ist aber die Frage nach den politischen Rechten von Individuen noch nicht beantwortet. Diese gilt es in den internationalen Beziehungen zu stärken. Da sich die Menschen bereits in politischen Völkern konstituiert haben, ist es aber nicht plausibel, die Völker kosmopolitisch «wegzuvernünfteln» und zu behaupten, dass jetzt nur noch Individuen politische Rechte haben sollen.
Die Theorie der Demokratie zwischen Völkern sollte auf der Voraussetzung beruhen, dass sowohl die Individuen als auch die bereits konstituierten Völker politische Rechte haben. Besonders bei der Gründung und dem Beitritt zu den multilateralen Gremien führt politisch kein Weg an den bereits konstituierten Völkern vorbei. Demokratie bedeutet hier zunächst, dass der Beitritt zu multilateralen Organisationen und die Zustimmung zu deren Grundregeln direkt an den Bürgerwillen zurückgebunden werden muss. Das nationale Parlament ist dazu ein ungenügendes Organ, wie das Beispiel der EU zeigt. Die nationalen Parlamente haben alle Verträge ratifiziert, die Anerkennung der EU durch die Bürger liegt aber seit der politischen Union von Maastricht unter 50 Prozent. Auch die Existenz eines supranationalen Parlaments, das die EU als einzige multilaterale Organisation besitzt, vermag darin nichts zu ändern.
Die Parlamentarisierung multilateraler Organisationen mit demokratischen Mitgliedstaaten ist daher sicher wünschbar. Mehrstufige Vielvölkersysteme tendieren aber zu einer Verlängerung der Repräsentationsketten und zu undurchsichtigen Verhandlungslösungen. Die demokratische Luft wird immer dünner, je mehr Völker dazu kommen. Die repräsentative Demokratie bleibt auch in der Demokratie zwischen den Völkern unverzichtbar. Periodische Wahlen sind der rechtsstaatliche Ersatz der permanenten Revolution, sie bilden die Grundkonstante der Demokratie. Aber sie vermögen das System der Vielvölkerherrschaft nur ungenügend an die Bürgerpräferenzen zurückzubinden.
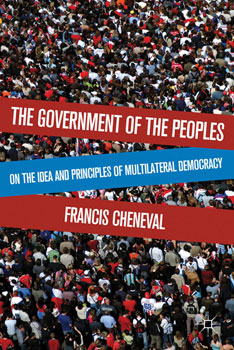
In der EU wurde dies erkannt. So gibt es seit April 2012 ein erstes zartes Pflänzchen direkter Demokratie in einer multilateralen Organisation: die Europäische Bürgerinitiative. Eine Million Unterschriften aus mindestens sieben Mitgliedstaaten bilden eine nicht verbindliche «Aufforderung» an die EU-Kommission, sich einem Thema zu zuwenden und einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. Volksabstimmungen werden dadurch nicht ausgelöst. Man kann dieser Initiative nur viel Erfolg wünschen, als direktdemokratisches Instrument zur Stärkung der individuellen politischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger ist sie aber ungenügend.
Optimisten sehen darin einen hoffnungsvollen Anfang, denn die Bürgerinnen und Bürger werden durch dieses «Aufforderungsrecht» für Gesetzesvorschläge auf die gleiche Stufe wie das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union gestellt. Pessimisten werden aber darin kaum mehr als ein Feigenblatt erkennen. Alle können sich aber mindestens in der Position finden, dass die Demokratisierung der EU und vergleichbarer multilateraler Organisationen auch über den vermehrten Einbezug direktdemokratischer Instrumente führen wird.