Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch

Ohne Netzwerke sind wissenschaftliche Karrieren kaum möglich. Und gerade in diesem Bereich ist die Ausgangslage für Frauen ungleich schwerer als für Männer. So eines der hauptsächlichen Resultate der Ende 2008 erschienenen Studie «Geschlecht und Forschungsförderung» (GeFo) des Schweizerischen Nationalfonds (SNF).
Die Studie macht deutlich, wie hoch die geschlechtsspezifische Verlustrate («Leaky Pipline») von Frauen in der Schweiz im Verlauf der wissenschaftlichen Laufbahn sind und welche Gründe es dafür gibt.
Ende letzte Woche diskutierten an der Universität Zürich (UZH) anlässlich des «Vernetzung-Anlasses des Fakultären Mentorings zur Studie Geschlecht und Forschungsförderung» rund 50 Wissenschafterinnen und einige wenige männliche Kollegen die Resultate und skizzierten Handlungsempfehlungen.
Qualität der Arbeit soll ausschlaggebend sein
Gleich zu Beginn formulierte Brigitte Tag, Präsidentin der Gleichstellungskommission der UZH, die Forderung, dass das Geschlecht für die wissenschaftliche Karriere eines Tages keine Rolle mehr spielen dürfe und für eine universitäre Laufbahn allein die Qualität der Arbeit und die Freude an Lehre und Forschung ausschlaggebend sein müssten.
Dass dem noch nicht so ist, lässt sich in der GeFo-Studie deutlich nachlesen. Regula Julia Leemann, unter anderem Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Zürich und Ko-Autorin, führte in ihrem Referat aus, dass sich zwar die Doktoratschancen von Frauen und Männer im Zeitraum von 2002 bis 2007 angenähert hätten, «aber nur in der Medizin und Pharmazie sind die Doktoratsquoten von Frauen und Männern ähnlich gross» (siehe Grafik 1). Interessant: «Die Quoten haben sich vor allem deshalb angenähert, weil Männer weniger doktorierten und nicht, weil Frauen zulegten.»
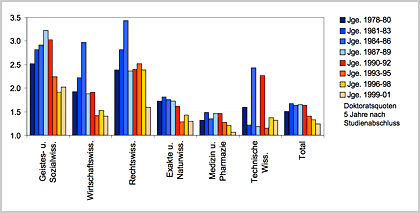
Geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen vor allem beim Übertritt ins Doktoratsstudium (Grafik 2). Die Differenzen in den Erfolgsquoten hingegen sind geringer. Erstaunlich findet Leemann, dass fünf Jahre nach dem Doktorat Frauen nicht seltener im Wissenschaftsbetrieb zu finden sind als Männer. «Frauen versuchen dranzubleiben», sagt sie, «aber sie sind schlechter eingebunden».
Allenfalls ist dies auch eine Erklärung dafür, dass Frauen generell weniger publizieren als Männer. Für den Zeitraum zwischen dem Doktorat und dem Befragungszeitpunkt (5 Jahre) weisen sie nur zwei Drittel so viele Publikationen auf wie Männer. Zudem haben Wissenschafterinnen offenbar die Tendenz mit der Veröffentlichung eines Textes länger zuzuwarten als Männer. Doch lassen sich darüber laut Leemann keine gesicherten Angaben machen. Grund: Die Art, Länge, Qualität und Relevanz von Publikationen konnte nur rudimentär erhoben werden.
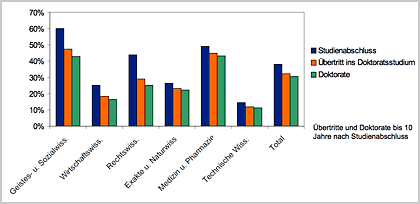
Klar hingegen ist, dass Weiterqualifikationen nicht zuletzt dadurch erschwert werden, weil Frauen Familienpflichten übernehmen.
Frauen haben weniger Mentorinnen und Mentore
Weibliche Doktorierte mit Kind/ern arbeiten zu rund 75 Prozent teilzeit. Männliche Doktorierte mit Kind/ern hingegen nur zu 20 Prozent. Kein Wunder finden Frauen auch weniger Zeit, sich zu vernetzen, Kongresse zu besuchen, Referate zu halten oder ins Ausland zu gehen.
Auffallend auch, dass Frauen angeben, seltener als Männer einen Professor oder eine Professorin als Mentor oder Mentorin zu haben. Jemand also, der/die sie nach dem Doktorat entscheidend unterstützt und fördert. Und allenfalls auch eine Vorbildfunktion ausübt und Perspektiven eröffnet. Zitat einer befragten Naturwissenschafterin: «Man fällt in ein Loch nach der Dissertation.» Es gebe keine Laufbahnplanung, was dazu führe, dass viele Frauen aussteigen würden.
«Wer hingegen während der Doktoratsphase gut unterstützt wird, hat auch grössere Chancen auf Integration und Erfolg nach dem Doktorat», konstatiert Leemann.
Viele Frauen äussern Zweifel, im Wissenschaftsbetrieb überhaupt bestehen zu können. «Ich kann nicht gleich viel, oder gleich lang arbeiten, wie jemand, der kein Kind hat», zitiert Leemann eine Juristin. «Das gibt einem manchmal schon das Gefühl: Ja schaff ich das? Werde ich dann ernst genommen? Oder kann ich mich dann etablieren?»
Familiengründung auch für Männer problematisch
Besonders schwierig wird es, wenn Abendtermine wahrzunehmen sind. Etwa nach 18 Uhr, wenn die Kinderkrippe geschlossen ist. Leemann räumt ein, dass die Gründung einer Famile auch für Väter, die wissenschaftlich weiter kommen möchten, «problematische Aspekte» haben kann. Doch könnten sie in der Kinderbetreuung «viel stärker auf ihre Partnerin setzen».
Wenig erstaunlich deshalb, dass «doktorierte Frauen generell weniger häufig Kinder haben als die Männer». Leemann fand auch Hinweise, dass «Frauen, die nicht auf Kinder verzichten wollen, die Weiterverfolgung ihrer Laufbahn in Frage stellen oder sie schon verlassen haben. Dieses Muster ist bei Männern kaum zu finden».
Klönen und wehklagen ist jedoch nicht angesagt. Für Leemann ist klar, dass die Daten und Resultate der GeFo-Studie nicht in der Schublade verschwinden dürfen. Die Förderpraxis des SNF sei «kaum das entscheidende geschlechtsspezifische Hindernis auf dem Forschungs-Karriereweg von Frauen». Dennoch ortet sie in den «Bereichen Integration, Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie sowie internationale Mobilität Handlungsbedarf».
Helfen könnten praktische Ratschläge, wie den Austausch mit Fachkolleginnen selber zu suchen. Oder dass es in Sachen Networking wenig bringt, an einer Tagung teilzunehmen, ohne ein Referat zu halten. Frauen sollten sich eine «thematische Nische» suchen und sich so einen Namen schaffen.
Auslandaufenthalte sollten auch gestaffelt möglich sein
An die Adresse der Institutionen ging der Wunsch, vermehrt Teilzeitstellen anzubieten und Jung-Wissenschafterinnen auch längerfristige Job-Perspektiven zu bieten. Ins Ausland zu gehen sei häufig nicht das Hauptproblem. «Schwierig ist das Zurückkommen und der Wiedereinstieg und nicht das Weggehen», brachte es eine Teilnehmerin auf den Punkt.
Elisabeth Maurer, Leiterin der Abteilung Gleichstellung der UZH, schlug vor, Auslandaufenthalte sollten künftig gestaffelt möglich sein und nicht wie bis anhin nur an einem Stück. Konkret: 12 Monate verteilt auf drei Jahre. Wichtig sei es auch, die Probleme der «Leaky Pipeline» faktultätsspezifisch und universitätsintern überhaupt zu diskutieren und ein Bewusstein dafür zu schaffen; dafür, dass Frauen wie Männer in verschiedenen Lebensphasen unterschiedlichen Fremd-Belastungen ausgesetzt sind.
Die zeitliche Verfügbarkeit für die wissenschaftliche Tätigkeit könne variieren. «Einmal sind es 150 Prozent, dann eine Zeitlang nur 50 Prozent.» Dies sage aber nichts über die Qualität der geleisteten Arbeit aus. «Das Ziel muss sein, dass Forschende, die solche Modelle leben möchten, in der Wissenschaft anerkannt werden.»